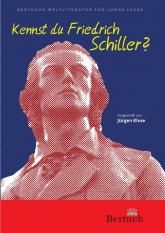Das Haus Werkbund, das von 1921 bis 1947 auf dem seit 1909 entstandenen Gelände der Frankfurter Messe stand, ist einer der verschwundenen Frankfurter Orte. Einst war das Haus ein Prestigeprojekt des 1907 gegründeten und 1947 neu gegründeten Deutschen Werkbunds, einer noch bestehenden Vereinigung von bildenden Künstlern, Architekten, Unternehmern und Kunstexperten mit Sitz in München, die sich gründete, um eine neue Warenästhetik unter der Prämisse einer Einheit von Form und Funktion zu erreichen. Der Deutsche Werkbund verfolgte jedoch nicht nur ästhetische Ziele, sondern hatte auch das wirtschaftliche Bestreben, durch qualitativ hochwertige Produkte die Position Deutschlands auf dem Weltmarkt zu stärken. Die Ideen des Werkbundes machten Schule und 1913 wurden auch in Österreich, der Schweiz und Ungarn Werkbünde gegründet. Der Bau des Hauses Werkbund in den Jahren 1920 und 1921 stand darüber hinaus im Zusammenhang mit einer Expansion der Frankfurter Messe nach dem Ersten Weltkrieg. Das Haus füllte eine Lücke an der damaligen Hohenzollernallee (heute: Theodor-Heuss-Allee). In den folgenden Jahren entstanden noch weitere Messegebäude, sodass sich die zur Verfügung stehende Ausstellungsfläche stetig vergrößerte.
Das Haus Werkbund wurde nach einem Entwurf von Fritz Voggenberger (1884-1924) erbaut, dessen Pläne sich in einem von der Arbeitsgemeinschaft des „Deutschen Werkbundes für den Mittelrhein“ veranstalteten Architekturwettbewerb durchgesetzt hatten. Das einen 65 Meter langen rechteckigen Riegel entlang der damaligen Hohenzollernallee bildende Gebäude fiel nicht nur wegen seiner roten Fassade auf dem Messegelände auf, denn es war – anders als die im Stil des Historismus gehaltene Festhalle – dem neuen architektonischen Stil des Expressionismus verpflichtet. Fritz Voggenberger war ein führender Frankfurter Vertreter dieser Stilrichtung. Die Fassade des Hauses Werkbund kombinierte runde beziehungsweise halbrunde Elemente, die Fenster, mit eckigen Elementen, den großen geometrischen Mustern auf der Fassade. Eröffnet wurde das Haus Werkbund zu Beginn der Herbstmesse 1921, und die Zeitungsartikel, die darüber berichteten, legten zwar ihren Fokus auf die künftige Verwendung des neuen Messehauses, lobten aber auch dessen ausgefallene Architektur. So berichtete etwa die „Badische Presse“, dass das neue Messegebäude „einen architektonisch interessanten und zugleich reizvollen Bau“ darstelle, „der das Bild der Frankfurter ‚Messestadt‘ glücklich“ belebe. Ein wenig Fremdeln mit dem neuen architektonischen Stil schwingt, trotz des Lobes, durchaus in den Zeilen mit.
Während der Frankfurter Herbstmesse, aber auch noch bei weiteren Messen diente das Haus Werkbund einerseits der „Kunstgewerblichen Qualitätsschau“, die im linken Gebäudeflügel stattfand, andererseits nahm es im rechten Flügel die Buchmesse auf. Darüber hinaus verfügte das Gebäude über einen großen Vortragssaal. Das „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel“ befasste sich in seinem Bericht vom 3.10.1921 über die Eröffnungsveranstaltung im Haus Werkbund nicht nur mit der Buchmesse, sondern auch mit der Kunstgewerbeschau, die es als „einen glücklichen und verheißungsvollen Anfang in dem Bestreben, nur wirklich hochwertige Erzeugnisse zu einer wirkungsvollen, geschlossenen Schau zusammenzufassen“ bezeichnete. Die dort gezeigten kunstgewerblichen Gegenstände sollten herausragende Beispiele für die Qualitätsvorstellungen des Werkbundes bieten.
Zunächst hatte der Werkbund Ähnliches mit der Leipziger Messe vorgehabt, aber weil er bei den Vertretern der dortigen Messe nicht genügend Verständnis für seine Vorstellungen fand, suchte er die Zusammenarbeit mit der Frankfurter Messe. Auch außerhalb der Messezeiten fanden im Haus Werkbund regelmäßig kunstgewerbliche Ausstellungen von Mitgliedern, aber auch Nichtmitgliedern des Werkbundes statt. Auch andere Ausstellungen und Veranstaltungen – wie etwa im Januar 1922 ein Lehrertag, der mit der Auswander-Ausstellung „Zweite Heimat“ verbunden wurde – wurden im Haus Werkbund gezeigt. Seitens des Frankfurter Messeamtes gestaltete die Berliner Designerin und Innenraumgestalterin Lilly Reich (1885-1947), die zu diesem Zweck aus Berlin nach Frankfurt übergesiedelt war, von 1924 bis 1926 regelmäßig Ausstellungen im Haus Werkbund. Reich hatte von 1908 bis 1911 bei den Wiener Werkstätten gearbeitet, war seit 1912 Mitglied des Deutschen Werkbunds und seit 1920 auch Mitglied in dessen Vorstand.
Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus Werkbund zerstört. Die Trümmerteile wurden 1947 abgetragen. Ein Neuaufbau wurde nicht diskutiert.
*****
Textquellen:
Die fünfte Frankfurter Internationale Messe in: Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, Montag, 3.10.1921, S. 70f.
Campbell:, Joan: The German Werkbund, The politics of reform in the applied arts, Princeton, N. J. 1978.
Fünderich, Maren Sophie: Wohnen im Kaiserreich. Einrichtungsstil und Möbeldesign im Kontext bürgerlicher Selbstrepräsentation, Berlin/Boston, 2019.
Hock, Sabine: Voggenberger, Fritz in: Frankfurter Personenlexikon (Onlineausgabe) abgerufen von >https://frankfurter-personenlexikon.de/node/4840< am 30.04.2025.
Kunstgewerbliche Qualitätsschau und Buchmesse im neuen Meßgebäude „Haus Werkbund“ in: Badische Presse. Dienstag, 27.9.1921, S. 9.
>https://www.deutscher-werkbund.de/wir-im-dwb/werkbund-geschichte/< abgerufen am 30.04.2025.
>https://de.wikipedia.org/wiki/Deutscher_Werkbund< abgerufen am 30.04.2025.
>https://de.wikipedia.org/wiki/Messe_Frankfurt< abgerufen am 30.04.2025.
>https://de.wikipedia.org/wiki/Lilly_Reich< abgerufen am 30.04.2025.
>https://museumderdinge.de/ueber-uns/deutscher-werkbund/akteurinnen-des-deutschen-werkbunds/lilly-reich/< abgerufen am 30.04.2025.
>https://www.feuilletonfrankfurt.de/2019/02/04/die-ausstellung-moderne-am-main-19191933-im-museum-angewandte-kunst/< abgerufen am 30.04.2025.
>https://www.stadtgeschichte-ffm.de/de/stadtgeschichte/stadtchronik/1922< abgerufen am 30.04.2025.
Bildquellen:
Vorschaubild: Deutscher Werkbund Logo 02.2017, Urheber: Deutscher Werkbund e.V. via Wikimedia Commons Gemeinfrei.
Lillyreich04, Urheber: design TOP 100 via Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0.